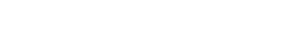Höchstrichterlich bestätigt: Erforderlichkeit richtet sich nach prognostischem Bedarf
Internetauftritt: BVerwG, U.v. 08.04.2025 – BVerwG 9 C 1.24
In der Praxis führen häufig die konkrete Planung von Erschließungsanlagen und die damit ausgelösten Kosten zu Unmut seitens der Anlieger. Gerne wird die Planung im Hinblick auf preiswertere Ausführungen oder kostengünstigere Gestaltungen hinterfragt. Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Diskussion um die Maßnahmenplanung ist (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m.) § 129 Abs. 1 BauGB, nach dem Beiträger „nur insoweit erhoben werden, als die Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden Flächen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen“. Bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes kommt der Kommune – gerade auch im Hinblick auf die Planungshoheit – ein großer Spielraum zu, der seine Grenzen dann erreicht, wenn die konkrete Planung sachlich schlechthin nicht vertretbar ist.
Der Fall:
Der Kläger wendet sich gegen die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Herstellung des rund 200 Meter langen östlichen Endes der G.-Straße in M.
In den Jahren 1985/1986 wurde das östliche, an die klägerischen Grundstücke grenzende Ende der G.-Straße vierspurig erbaut. Mit Bescheiden vom 25. Oktober 1991 zog die Beklagte den Rechtsvorgänger des Klägers zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag heran, die dieser nur für ein Grundstück bezahlte.
Ursprünglich plante die Beklagte, die G.-Straße vierspurig weiterzuführen. Im Jahr 1999 beschloss sie jedoch einen Bebauungsplan, der eine nur noch zweispurige Fortführung der Straße vorsah. In diesem Umfang wurde die G.-Straße in den Jahren 2003/2004 weitergebaut und im Juli 2007 in ihrer gesamten Länge als Gemeindestraße gewidmet.
Unter dem 4. September 2007 erließ die Beklagte gegen den Rechtsvorgänger des Klägers für die vorgenannten Grundstücke drei Erschließungsbeitragsbescheide.
Mit rechtskräftigem Urteil vom 17. Januar 2011 hob das Verwaltungsgericht Koblenz zwei der Bescheide mit der Begründung als nichtig auf, darin seien Flurstücke zu Unrecht als wirtschaftliche Einheit veranlagt worden.
Mit den vorliegend angefochtenen Bescheiden vom 24. August 2011 zog die Beklagte daraufhin den Rechtsvorgänger des Klägers für die Grundstücke, deren Beitragsbescheide aufgehoben worden waren, erneut zu Erschließungsbeiträgen heran und veranlagte ihn bezüglich des Flurstücks, dessen Bescheid nicht aufgehoben worden war, zu einem Nacherhebungsbetrag.
Das Verwaltungsgericht verpflichtete die Beklagte mit Urteil vom 25. Februar 2016, die Höhe der Beitragsbescheide unter Berücksichtigung eines kleinen Teils einer weiteren, nicht im klägerischen Eigentum stehenden Parzelle neu zu berechnen. Im Übrigen wies es die Klage ab.
Das Oberverwaltungsgericht wies die Berufung des Rechtsvorgängers des Klägers mit Urteil vom 6. November 2017 zurück.
Mit der vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen Revision hat der Rechtsvorgänger des Klägers mehrere Einwände gegen die angefochtenen Bescheide erhoben und unter anderem das Fehlen einer absoluten zeitlichen Höchstgrenze für die Heranziehung zu Beitragszahlungen gerügt.
Die obergerichtliche Entscheidung (in Auszügen):
Das BVerwG hat erneut den Gestaltungsspielraum der Kommunen für die Planung der Maßnahmenausführung herausgearbeitet:
„Ebenfalls im Einklang mit Bundesrecht hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt, dass der Gemeinde bei der Bestimmung des nach § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB Erforderlichen ein weiter Entscheidungsspielraum zusteht, der erst überschritten ist, wenn die im Einzelfall gewählte Lösung sachlich schlechthin unvertretbar ist (stRspr, vgl. BVerwG, Urteil vom 3. März 2004 - 9 C 6.03 - DVBl 2004, 1038). Zutreffend ist die Vorinstanz darüber hinaus davon ausgegangen, dass sich die Erforderlichkeit (auch) anhand des Bedarfs bestimmt, mit dem prognostisch unter Berücksichtigung einer voraussehbaren Entwicklung vorsorglich gerechnet werden muss. Dies schließt Entwicklungen ein, die sich nach der bebauungsrechtlichen Rechtslage künftig durch die Aufnahme oder Änderung gewerblicher oder industrieller Nutzungen ergeben können (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. August 1993 - 8 C 36.91 - NVwZ 1994, 905 <907>). Auch darf die Gemeinde bei der Entscheidung, mit welcher Breite eine Erschließungsanlage hergestellt wird, den Gesichtspunkt der Leichtigkeit des Verkehrs in ihre Überlegungen einbeziehen (vgl. BVerwG, Urteile vom 8. August 1975 - 4 C 74.73 - BayVBl 1976, 281 und vom 24. November 1978 - 4 C 18.76 - DVBl 1979, 780).“
Für den konkreten Fall bedeutet das, der Kläger im Rechtsmittel hätte darlegen müssen, dass die richterliche Überzeugungsbildung in den Vorinstanzen gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verstoßen hat, als es die Erforderlichkeit der geplanten und durchgeführten Maßnahme überprüfte. Dies gelang nicht.
Unsere Hinweise:
Die vorgestellte Entscheidung legt noch einmal anschaulich die Grundzüge des erschließungsbeitragsrechtlichen Erforderlichkeitsbegriffs und die unterschiedlichen Anforderungen an dessen Überprüfung im Instanzenzug dar.
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie ab der Randnr. 241 weitere Hinweise zur Erforderlichkeit einer Maßnahme.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite