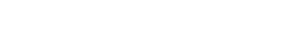Es war einmal ein „Beitragsverzicht“ aus den 1970ern…
Immer wieder stößt die Gemeindeverwaltung in ihren Unterlagen auf alte, längst vergessene Vereinbarungen, Bescheide oder einfache Schriftstücke, in denen die Gemeinde vor dreißig, vierzig oder gar fünfzig Jahren gegenüber einzelnen Bürgern entweder komplett ohne Kontext oder unter eher merkwürdigen Umständen auf einen Beitrag verzichtet wird. Derartige „Zusicherungen“ sind in der Regel rechtswidrig, führen aber auch fast immer zu Streit, da sich die Bürger auf die Aussage der Gemeinde verlassen haben. Einen ganz typischen Fall stellen wir im Folgenden vor:
Der Fall:
Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrags vom 16.8.1973 zwischen Gemeinde und dem Rechtsvorgänger der Antragstellerinnen wurde u.A. vereinbart, dass „die Erwerber und deren Rechtsnachfolger im Eigentum keine Erschließungskosten, gleich welcher Art diese auch sein mögen und zu welchem Zeitpunkt sie bereits entstanden sind bzw. noch entstehen werden, […] zu bezahlen [haben]. Dies wird den Erwerbern seitens der Gemeinde […] ausdrücklich zugesichert.“ Die Gemeinde möchte 2020 die hier streitgegenständliche Straße, an der das Grundstück der Antragstellerinnen anliegt, fertigstellen und einen Erschließungsbeitrag herstellen. Sie informiert mit Schreiben vom 28.7.2020 sämtliche Anlieger, die Klägerinnen erhalten in diesem Zuge dasselbe Informationsschreiben, das bei Ihnen aber den Passus enthält: „voraussichtliche Vorausleistungsbetrag für dieses Grundstück beträgt unter Berücksichtigung der ausbedungenen Erschließungsbeitragsfreiheit: 0,00 €“. Im Februar 2021 äußert die Gemeinde erstmals explizit Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vereinbarung von 1973 und mit Bescheid vom 26.8.2021 werden die Antragstellerinnen zu einer Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag i.H.v. 9.300 EUR herangezogen. Gegen diesen Bescheid gehen die Antragstellerinnen im Wege des Eilrechtsschutzes vor.
Die obergerichtliche Entscheidung:
Das OVG wies den Eilantrag ab. Die Gemeinde dürfe Vorausleistungen erheben und weder die Vereinbarung von 1973 noch widersprüchliches Verhalten stehe der Beitragserhebung entgegen.
Die “Zusicherung“ der Beitragsfreiheit von 1973 ist als – nichtige – Ablösungsvereinbarung zu qualifizieren.
Es entspricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, „dass die 1973 erfolgte „Zusicherung“ der Beitragsfreiheit als nichtige Ablösungsabrede im Sinne des § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB zu qualifizieren ist, da – erstens – eine Gemeinde von der Möglichkeit des Ablösungsvertrages aus Gründen der Abgabengerechtigkeit und -gleichheit nur wirksam Gebrauch machen kann, wenn zuvor ausreichende Ablösungsbestimmungen erlassen worden sind, die festlegen, wie der mutmaßliche Erschließungsaufwand zu ermitteln und zu verteilen ist, woran es fallbezogen indes unstreitig fehlte.“ Zweitens wurde „der vereinbarte Ablösebetrag nicht hinreichend offengelegt wurde. Auch dieses Defizit begründet nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Nichtigkeit der Ablösungsabrede, da ohne eine solche Offenlegung die Schranken, die der Gesetzgeber der Zulässigkeit von Ablösungsverträgen gesetzt hat (vgl. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB), in ihrer tatsächlichen Auswirkung ins Leere gingen.“
Das Schreiben vom 28.7.2020 ist ebenfalls nicht als Zusicherung eines Beitragsverzichts zu verstehen.
Das OVG hat das Anliegerinformationsschreiben vom 28.7.2020 nicht als Zusicherung im Sinne des § 38 VwVfG ausgelegt, nach der die Gemeinde „(auch) künftig davon absehen [werde], einen Erschließungsbeitrag zu erheben. Dem Schreiben kann ein Rechtsbindungswille der Gemeinde – insbesondere im Sinne eines Verzichts (§ 135 Abs. 5 Satz 1 BauGB) bzw. einer entsprechenden Zusicherung – nicht entnommen werden. Von einem Verzicht auf die Erhebung von Beiträgen kann regelmäßig nur dann die Rede sein, wenn die Verzichtserklärung eindeutig ist. Eine solche gemeindliche Erklärung muss gegenüber dem Beitragspflichtigen eine eigenständige Regelung enthalten und eine selbstständig verbindliche Verfügung darstellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind dabei aufgrund der im Grundsatz unabdingbaren gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinden zur Beitragserhebung (vgl. § 127 Abs. 1 BauGB) an die Annahme eines Verzichtswillens hohe Anforderungen zu stellen. Im Zweifel ist nicht der innere, sondern der erklärte Wille maßgebend, wie ihn der Empfänger bei verständiger Würdigung des objektiven Erklärungswerts und der weiteren Begleitumstände, insbesondere des Zwecks der Erklärung, verstehen konnte (objektiver Empfängerhorizont). Insofern ist unter anderem von Bedeutung, ob eine gemeindliche Äußerung lediglich als Wissenserklärung bzw. als „Zwischenschritt“ (etwa als Kundgabe des aktuellen Stands der kommunalen Willensbildung) einzuordnen ist, oder aber als abschließende rechtsverbindliche Äußerung einer (Verzichts-)Entscheidung. Nach dieser Maßgabe überzeugt die Einschätzung […] nicht, der Antragsgegner habe mit Schreiben vom 28.7.2020 gegenüber den Antragstellerinnen rechtsverbindlich erklärt, ein Erschließungsbeitrag werde künftig nicht erhoben. Gegen die Annahme eines Verzichtswillens spricht bereits die Tatsache, dass das als „Anliegerinformation“ überschriebene Schreiben sich im Wesentlichen inhaltsgleich erkennbar an alle Anlieger der streitgegenständlichen und der benachbarten Erschließungsanlage richtete und primär dem Zweck diente, alle Betroffenen über Ablauf und Kosten der Baumaßnahmen nach dem damaligen Planungsstand in Kenntnis zu setzen. Ein verbindlicher Verzicht (bzw. eine entsprechende Zusicherung) gegenüber den Antragstellerinnen kann dem Schreiben zudem – worauf [die Gemeinde] zutreffend hinweist – schon mit Blick auf seinen Wortlaut nicht entnommen werden. Denn der in Aussicht gestellte Beitrag von „0,00 €“ ist dort (nur) als „voraussichtlicher Vorausleistungsbetrag“ bezeichnet und stellt sich damit gerade nicht als abschließende Entscheidung dar. Hinzu kommt, dass das genannte Schreiben die Beitragsfreiheit der Antragstellerinnen ausdrücklich mit einem Hinweis auf die im Jahr 1973 „ausbedungene Erschließungsbeitragsfreiheit“ begründet. Es handelt sich dabei um einen bloßen Hinweis auf eine zu einem früheren Zeitpunkt getroffene Abrede. Es liegt bei verständiger Würdigung hingegen fern, dass [die Gemeinde] mit dieser Passage die Rechtsfolge der Beitragsfreiheit im Juli 2020 konstitutiv herbeiführen wollte, zumal die Nichtigkeit der notariellen Ablösungsabrede zu diesem Zeitpunkt zwischen den Beteiligten – wie die Antragstellerinnen selbst ausführen – noch nicht thematisiert worden war.“
Verstoß gegen Trau und Glauben ist erst auf Ebene der Beitragserhebung und nicht bei der Beitragsfestsetzung zu prüfen.
„Der Vorausleistungsbescheid vom 26.8.2021 ist aller Voraussicht nach auch nicht wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben rechtswidrig. Dabei kann letztlich offenbleiben, ob sich die Heranziehung der Antragstellerinnen in der Sache als treuwidrig darstellt, da sie aufgrund der notariellen Vereinbarung des Jahres 1973 über lange Zeit – jedenfalls seit 2014 (Eintritt der Erbfolge) – in der Erwartung lebten, für ihr Grundstück werde ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben und der Antragsgegner dieses Vertrauen – wenngleich ohne Rechtsbindungswillen – mit Schreiben vom 28.7.2020 bestärkt hat.“
Grundsätzlich gilt zwar, dass die Pflicht, Treu und Glauben zu genügen, sich auf das öffentliche Recht erstreckt.
„Jedoch schließt § 135 Abs. 5 Satz 1 und 2 BauGB, wonach die Gemeinde von der Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz oder teilweise absehen bzw. freistellen kann, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist, den Einwand unzulässiger Rechtsausübung auf Festsetzungsebene nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts als spezialgesetzliche Regelung für die Fallgruppe eines widersprüchlichen Verhaltens der Gemeinde im Vorfeld einer Erschließungsbeitragserhebung aus. Die Frage des treuwidrigen Verhaltens der Gemeinde ist in diesen Fällen, anders ausgedrückt, erst auf der nachgelagerten Ebene des Beitragserlasses nach Maßgabe des § 135 Abs. 5 BauGB zu prüfen, berührt aber die Rechtmäßigkeit der alleine in Streit stehenden Festsetzung eines erschließungsrechtlichen (Vorausleistungs-) Beitrags nicht. In diesem Sinne hat der Senat bereits entschieden, dass aus einer rechtsunwirksamen Zusage der Gemeinde, einen bestimmten Beitrag nicht zu erheben, in Ausnahmefällen die Pflicht zu einem Billigkeitserlass folgen kann. Der Anspruch auf eine solche Billigkeitsentscheidung kann nach Durchlaufen eines entsprechenden Vorverfahrens mit der Verpflichtungsklage geltend gemacht werden. Das gilt auch, wenn die Gemeinde offensichtlich erkennbare Umstände, die aus sachlichen Gründen einen (Teil- )Billigkeitserlass nach § 135 Abs. 5 BauGB gebieten mögen, im Heranziehungsverfahren nicht berücksichtigt.“ Mit anderen Worten ausgedrückt: Ob die Beitragserhebung gegen Treu und Glauben verstößt ist zunächst einmal irrelevant. Die Gemeinde hat den Erschließungsbeitrag ganz normal zu erheben und die Beitragspflichtigen müssen dann in einem zweiten Schritt einen Billigkeitserlass nach § 135 Abs. 5 BauGB beantragen. Genehmigt die Gemeinde diesen nicht, dann ist nicht der Erschließungsbeitragsbescheid mittels Widerspruchs und Klage anzugreifen, sondern vielmehr die Gemeinde auf Erteilung des Erlasses zu verklagen.
Beitragserlass kommt nur bei für den Beitragsschuldner untragbare seine Existenz berührende Folgen in Betracht.
„Lediglich der Vollständigkeit halber – und ohne, dass es streitentscheidend darauf ankäme – weist der Senat darauf hin, dass die Annahme einer unbilligen (treuwidrigen) Härte im Verständnis des § 135 Abs. 5 BauGB fallbezogen nach Lage der Akten in der Sache problematisch erschiene. Zwar betonen die Antragstellerinnen zu Recht, dass sie seit erheblicher Zeit in der Erwartung lebten (und wirtschafteten), an den Kosten der Herstellung der [streitbefangene Straße] nicht beteiligt zu werden, zumal das 1973 begründete Vertrauen in die Erschließungsbeitragsfreiheit dadurch bekräftigt wurde, dass eine Heranziehung zu einer ersten Vorausleistung anlässlich des Vorstufenausbaus der Anlage (1973–1975) nach unbestrittener Einlassung der Antragstellerinnen unterblieben ist. Hinzu kommt, dass das Anliegerinformationsschreiben vom 28.7.2020, wie dargestellt, auf die notarielle Abrede ohne Einschränkung Bezug nimmt. Dem steht jedoch gegenüber, dass sich ein Abgabenschuldner in Ansehung einer wegen eines Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtigen Vereinbarung, auf deren Bestand sich sein Vertrauen maßgeblich stützt, nicht darauf berufen kann, es verstoße gegen Treu und Glauben, wenn diese Vereinbarung nicht als rechtswirksam behandelt werde. Im Erschließungsbeitragsrecht kommt allgemein dem öffentlichen Interesse an einer rechtmäßigen Beitragserhebung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften mehr Gewicht zu als dem Interesse eines Anliegers, der sich auf Treu und Glauben beruft. Nur auf diese Weise kann eine – mit Blick auf die dem Erschließungsbeitragsrecht immanenten Grundsätze der Abgabengerechtigkeit und Abgabengleichheit gebotene – möglichst gleichmäßige Heranziehung aller Beitragspflichtigen sichergestellt werden. Das Berufen der Gemeinde als Beitragsgläubigerin auf die Nichtigkeit einer Ablösungsvereinbarung kann sich als treuwidrig darstellen, wenn daraus für den Beitragsschuldner untragbare seine Existenz berührende Folgen erwüchsen. Dafür spricht fallbezogen indes wenig, zumal der gesetzes- und satzungsmäßige Erschließungsbeitrag nur die dem erschlossenen Grundstück durch die Straßenbaumaßnahme gebotenen und fortbestehenden Vorteile ausgleicht. Hinzu kommt, dass die Parteien des Tauschvertrags 1973 – wie erwähnt – von der Gleichwertigkeit des eingebrachten Ackerlandes und des zugeteilten Baulandes ausgingen, so dass eine wirtschaftliche Übervorteilung der damaligen Erwerber bzw. der Antragstellerinnen durch den Anfall von Erschließungsbeiträgen nicht erkennbar ist. Im Übrigen erscheint nach Aktenlage fraglich, ob die (einzig) mit Schriftsatz vom 23.3.2020 näher angeführte Vermögensdisposition, die „dringend notwendige Renovierung eines Badezimmers der Familie R... […] im Frühjahr 2021“ auf Grundlage im Oktober 2020 eingeholter Angebote eine hinreichende Darlegung der Betätigung geschützten Vertrauens darstellt. Denn zum einen wurde die geltend gemachte finanzielle Belastung nicht näher substantiiert und zum anderen hatte der Antragsgegner bereits mit Schreiben vom 4.2.2021 Zweifel an der Wirksamkeit der notariell beurkundeten Beitragsfreiheit geäußert.“
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie die Erläuterungen zur Wirksamkeit von Ablöseverträgen in den Rdnrn. 1520 ff. und zur Rechtmäßigkeit von Billigkeitsmaßnahmen in den Rdnrn. 1712 ff.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite