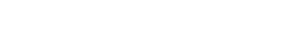Erschließungsbeitragsbescheid gegenüber einer Erbengemeinschaft
Der Fall:
Die Klägerin wendet sich gegen die Festsetzung eines Erschließungsbeitrags für einen Abschnitt einer Erschließungsanlage. Ihren Angaben zufolge ist sie, nachdem der ursprüngliche Eigentümer, ihr Vater xxx, im Jahr 2010 verstorben ist, gemeinsam mit ihren Brüdern xxx und xxx in ungeteilter Erbengemeinschaft Eigentümerin des im Gemeindegebiet der Beklagten gelegenen Grundstücks ….
Für dieses Grundstück setzte die Gin der Folge beklagte baden-württembergische Gemeinde mit Bescheid vom 03.11.2021, der an die Klägerin adressiert war, für die endgültige Herstellung eines Abschnitts der Erschließungsanlage „xxx-Weg“ einen Erschließungsbeitrag fest. In der Begründung des Bescheids wurde unter anderem ausgeführt, Beitragsschuldner sei nicht die (ungeteilte) Erbengemeinschaft als Gesamthandsgemeinschaft, sondern dies seien die Mitglieder der Erbengemeinschaft als Gesamtschuldner. Der Gemeinde stehe es frei, ob sie alle Gesamtschuldner oder etwa nur einen der Gesamtschuldner in Anspruch nehme. Man habe sich entschieden, den Beitragsbescheid an die spätere Klägerin zu adressieren.
Der Beklagten ging daraufhin ein Schreiben zu, in dem unter dem Briefkopf des Herrn „xxx“ ausgeführt wurde: „Frau xxx (die Klägerin) vertritt die Erbengemeinschaft xxx, die die Eigentümerin des betreffenden Grundstücks und der Immobilie ist. Diese Erbengemeinschaft besteht aus nachfolgenden drei Personen (…). Es werde Widerspruch gegen den Erschließungsbeitragsbescheid erhoben. Der Beitragsbescheid sei rechtswidrig, weil er eine beitragsfreie Straße betreffe, die seit mehreren Jahrzehnten für einen objektiven Bürger erkennbar fertiggestellt gewesen sei.
Daraufhin teilte die Beklagte Herrn xxx mit, dass der eingegangene Widerspruch nicht zulässig sein dürfte. Er selbst sei nicht Adressat des Bescheids, die Erbengemeinschaft sei weder rechtsfähig noch widerspruchsbefugt. Daraufhin legitimierte sich der Prozessvertreter der Klägerin für die Mitglieder der Erbengemeinschaft und führte aus, dem Widerspruchsschreiben sei eindeutig zu entnehmen, dass insbesondere auch im Namen der Klägerin Widerspruch gegen den Beitragsbescheid erhoben werden sollte. Eigentlich betroffen sei die Erbengemeinschaft. Die Beklagte habe es indes versäumt, Bescheide gegen die übrigen Miterben zu erlassen.
Der Widerspruch blieb erfolglos. Mit an sämtliche Miterben gerichteten gleichlautenden Widerspruchsbescheiden wurde der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, eine Erbengemeinschaft sei nach ständiger Rechtsprechung nicht rechtsfähig und auch nicht gemäß § 61 Nr. 2 VwGO beteiligungsfähig oder nach § 42 Abs. 2 VwGO widerspruchsbefugt. Bei Gesamthandsgemeinschaften - also auch bei Erbengemeinschaften - sei jedes Mitglied Eigentümer der Sache, die zum Vermögen der Gesamthandsgemeinschaft gehöre. Beitragsbescheide seien an die einzelnen Miterben, nicht aber an die Erbengemeinschaft zu richten. Es stehe im Auswahlermessen der Gemeinde, ob sie alle Gesamtschuldner je einzeln oder etwa nur einen der Gesamtschuldner in Anspruch nehme. Dieses Ermessen sei vorliegend dahingehend ausgeübt worden, dass der Bescheid (nur) an die Klägerin gerichtet worden sei. Die Erbengemeinschaft könne daher nicht in ihren Rechten verletzt sein und sei deshalb nicht widerspruchsbefugt. Die Klägerin als Adressatin des Beitragsbescheids habe selbst keinen Widerspruch erhoben. Das Widerspruchsschreiben sei dahingehend auszulegen, dass die Miterben für sich selbst als natürliche Personen keinen Widerspruch hätten einlegen wollen und sie ihre Unterschrift ausschließlich für die Erbengemeinschaft geleistet hätten.
Die Klage blieb in erster Instanz erfolglos.
Die obergerichtliche Entscheidung:
Der gerichtlichen Entscheidung sind die folgenden Grundsätze zu entnehmen:
„Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG wird durch die Regelung einer auf den Bereich des Anschluss- und Erschließungsbeitragsrechts beschränkten Teilrechtsfähigkeit einer Erbengemeinschaft nicht berührt. Die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit ist von der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit zu unterscheiden (…). Zivilrechtlich rechtsfähig ist derjenige, der Träger von bürgerlich-rechtlichen Rechten und Pflichten zu sein kann; die öffentlich-rechtliche Rechtsfähigkeit meint dagegen die Fähigkeit, Träger öffentlich-rechtlicher Rechte und Pflichten zu sein.
Dabei ist die Abgabenrechtsfähigkeit … eine spezielle Form der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit (…). Wegen der Relativität der Rechtsfähigkeit deckt sie sich nicht mit der zivilrechtlichen Rechtsfähigkeit (…). So ist etwa die Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft im Umsatzsteuerrecht (…) und im Grunderwerbssteuerrecht (…) anerkannt.
Die abgabenrechtliche Handlungsfähigkeit der Erbengemeinschaft regelt § 34 AO, der über § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a KAG auch im landesrechtlich geregelten Kommunalabgabenrecht Anwendung findet. Bei Erbengemeinschaften haben nach § 34 Abs. 2 Satz 1 AO alle Miteigentümer die abgabenrechtlichen Pflichten im Sinne des § 34 Abs. 1 AO zu erfüllen, also insbesondere dafür zu sorgen, dass die Abgaben aus den Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten (§ 34 Abs. 1 Satz 2 AO). Die Behörde kann sich nach § 34 Abs. 2 Satz 2 AO an jeden Miterben halten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Miterbe als Abgabenschuldner mit seinem eigenen Vermögen einstehen muss; Abgabenschuldner bleibt die Erbengemeinschaft.“
Es genügt die Bekanntgabe an einen der Miterben:
„Der Abgabenbescheid ist gemäß § 122 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b KAG der Erbengemeinschaft als Abgabenschuldnerin, d. h. grundsätzlich allen Mitgliedern der Erbengemeinschaft, bekanntzugeben; nach § 122 Abs. 1 Satz 2 AO findet allerdings § 34 Abs. 2 AO entsprechende Anwendung. Es genügt also die Bekanntgabe an einen Miterben, wobei der Bescheid auch in diesem Fall zur Identifizierung der Erbengemeinschaft den Namen des Erblassers und in der Regel auch die Namen der einzelnen Miterben angeben muss (…).
Regeln somit einzelne Rechtssätze des öffentlichen Rechts, dass Gebilde, die nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähig sind, in Teilbereichen des öffentlichen Rechts - etwa im Bereich des Abgabenrechts - beschränkt rechtsfähig sind, so wird der Regelungsbereich des bürgerlichen Rechts, für den der Bund nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz besitzt, nicht berührt.“
„Auch die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Bodenrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG steht der landesrechtlichen Regelung einer abgabenrechtlichen Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft nicht entgegen.“ <wird im Folgenden ausgeführt>
„Der Begriff des „Rechts der Erschließungsbeiträge“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG knüpft normativ-rezeptiv an das zum Zeitpunkt der Verfassungsänderung bestehende einfache Recht an, welches das Recht der Erschließungsbeiträge in §§ 127 ff. BauGB als einen klar umrissenen, in sich geschlossenen Normenkomplex geregelt hat. Der durch die Föderalismusreform I im Jahr 1994 auf die Länder übertragene Kompetenzbereich des „Rechts der Erschließungsbeiträge“ ist deshalb unter Rückgriff auf die in §§ 127 ff. BauGB enthaltenen Regelungen zu bestimmen (…).
Zur Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer:
„Hiervon ausgehend erstreckt sich die Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers für das Recht der Erschließungsbeiträge auch auf die Regelung des Erschließungsbeitragsschuldners. Die in § 21 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KAG getroffenen Regelungen zum Beitragsschuldner waren im Jahr 1994 nahezu wortgleich in § 134 Abs. 1 BauGB normiert; lediglich den in § 134 Abs. 1 BauGB verwendeten Begriff des Beitragspflichtigen hat der Landesgesetzgeber präzisiert und durch den Begriff des Beitragsschuldners ersetzt. Da dem Landesgesetzgeber durch die Föderalismusreform I eine eigene Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Erschließungsbeiträge eröffnet werden sollte, unterfällt es auch seiner Kompetenz, die zuvor in § 134 Abs. 1 BauGB getroffenen Regelungen zum Beitragspflichtigen bzw. zum Beitragsschuldner inhaltlich zu modifizieren. Damit ist dem Landesgesetzgeber kompetenzrechtlich auch die mit § 21 Abs. 3 KAG umgesetzte Möglichkeit eröffnet, die Erbengemeinschaft selbst als Beitragsschuldner zu bestimmen und hiermit eine - auf das Anschluss- und Erschließungsbeitragsrecht beschränkte - öffentlich-rechtliche Teilrechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft zu begründen.“
Die Rechtsprechung des BVerwG steht nicht entgegen:
„Das von der Beklagten angeführte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.09.2015 (- 4 C 3.14 - juris Rn. 10), in dem dieses schlicht festgestellt hat, die Erbengemeinschaft habe keine Rechtspersönlichkeit und könne „als solche“ nicht für öffentlich-rechtliche Beitragspflichten haftbar gemacht werden, steht der Annahme einer auf das landesrechtlich geregelte Anschluss- und Erschließungsbeitragsrecht beschränkten Abgabenrechtsfähigkeit von Erbengemeinschaften nicht entgegen. Denn Streitgegenstand dieses Urteils war ein bundesrechtlich in § 154 BauGB geregelter sanierungsrechtlicher Ausgleichsbetrag und nicht ein - der Regelungskompetenz des Landesgesetzgebers unterstehender - Erschließungsbeitrag.“
Die spezielle gesetzliche Regelung in Baden-Württemberg:
„§ 21 Abs. 3 KAG kann auch nicht so ausgelegt werden, dass diese Vorschrift die Erbengemeinschaft als Gesamthandsgemeinschaft nicht als alleinige Beitragsschuldnerin bestimmt, sondern die Beitragsschuldnerschaft der Erbengemeinschaft zusätzlich zu einer aus § 21 Abs. 1 Satz 1 KAG folgenden Beitragsschuldnerschaft der Mitglieder der Erbengemeinschaft regelt mit der Folge, dass sowohl die Erben als auch die Erbengemeinschaft gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 KAG als Gesamtschuldner Beitragsschuldner sind. Die Absicht, die Gesamthandsgemeinschaft als zusätzlichen Beitragsschuldner zu bestimmen, ergibt sich weder aus den Gesetzgebungsmaterialien noch aus dem Wortlaut des § 21 Abs. 3 KAG. Dort heißt es vielmehr, Beitragsschuldner ist „die Gesamthandsgemeinschaft“; es wird dort nicht formuliert, Beitragsschuldner ist „auch die Gesamthandsgemeinschaft“. Angesichts dieses eindeutigen Wortlauts der Vorschrift wäre die Annahme einer (zusätzlichen) eigenen Beitragsschuld der Erben nicht hinreichend erkennbar und würde deshalb rechtsstaatlichen Bedenken begegnen. Nach den dargelegten rechtlichen Grundsätzen hat die Beklagte mit dem angegriffenen Beitragsbescheid zu Unrecht die Klägerin als Miterbin anstelle der Erbengemeinschaft als Beitragsschuldnerin herangezogen. In dem an die Klägerin adressierten Bescheid … wird ausdrücklich ausgeführt, Beitragsschuldner sei nicht die (ungeteilte) Erbengemeinschaft als Gesamthandsgemeinschaft, sondern dies seien die einzelnen Miterben als Gesamtschuldner. Der Beitragsbescheid ist deshalb insoweit auch nicht auslegungsfähig.“
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. Die Entscheidung enthält eine Fülle von Hinweisen auf die einschlägige Rechtsprechung und Literatur. Sie finden außerdem weitergehende Hinweise zum Umgang mit Erbengemeinschaften im Erschließungsbeitragsrecht in Ihrem Matloch/Wiens insbes. bei Rdnr. 1148.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite