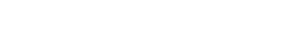Der Erschließungsbeitrag und das Bauordnungsrecht
Der Fall:
Die Klägerin ist Eigentümerin eines mit drei Wohngebäuden bebauten Grundstücks. Die streitgegenständliche Straße wäre für das Grundstück eine Zweiterschließung. Zwischen Straße und Grundstück liegt ein ca. 2m breiter Grünstreifen, der im Eigentum der Gemeinde steht. Dieser Grünstreifen ist teilweise eingezäunt, teilweise durch eine Stützmauer eingefasst. Zudem verläuft auf dem dargestellten Geländestreifen von der Erschließungsanlage zum Grundstück der Klägerin ein befestigter Fußweg, der den vorhandenen Höhenunterschied von ca. 1,5 m mit einer Treppe überwindet; der Zaun ist an dieser Stelle unterbrochen.
Als die Gemeinde einen Erschließungsbeitrag erhebt, geht die Klägerin gegen diesen gerichtlich vor. Wäre die Ersterschließung nicht, dann dürfte sie das Grundstück allein aufgrund der jetzt angelegten Zweiterschließung nicht bebauen, da das Grundstück dann nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzes hinsichtlich der Zufahrt genügen würde.
Die gerichtliche Entscheidung:
Diese Argumentation hatte vor dem OVG keinen Erfolg.
Zum Verhältnis von Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, wenn es um die Zugänglichkeit zu einem Grundstück geht:
„Nach § 29 Abs. 2 BauGB bleiben die Vorschriften des Bauordnungsrechts vom bundesrechtlichen Bebauungsrecht unberührt. Deshalb können die Anforderungen, die das Landesrecht, insbesondere das Bauordnungsrecht, an die verkehrliche Erreichbarkeit stellt, bei der Beurteilung der abstrakten Bebaubarkeit […] nicht unberücksichtigt bleiben. Allerdings sind der möglichen Kumulierung von (Erreichbarkeits-)anforderungen sowohl des Bundesrechts (Bebauungsrechts) als auch des Bauordnungsrechts Grenzen gesetzt. Das Bauordnungsrecht der Länder darf zwar mit dem, was für die hinreichende Zugänglichkeit des Baugrundstücks verlangt wird, über das hinausgehen, was das Bundesrecht für das hinreichende Erschlossensein fordert. Das Bauordnungsrecht kann etwa höhere Anforderungen an die Zugänglichkeit im Interesse des Brandschutzes stellen. Es darf jedoch das Bundesrecht lediglich „ergänzen“, nicht hingegen derart unterlaufen, dass es ohne überzeugende Gründe die vom Bundesrecht gestellten Anforderungen - genauer: die vom Bundesrecht im Interesse der Bebaubarkeit von Grundstücken geübte Zurückhaltung - leerlaufen lässt […].“
Vor diesem rechtlichen Hintergrund begegnen der landesrechtlichen Bauordnungsvorschrift, nach der Gebäude nur errichtet werden dürfen, wenn das Grundstück in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat, im Hinblick auf seine Erreichbarkeitsanforderungen keinen Bedenken. „Die Vorschrift verlangt im Grundsatz ebensowenig wie §§ 30 ff. BauGB, dass auf das Baugrundstück mit Kraftfahrzeugen heraufgefahren werden kann. Deshalb ist die bauordnungsrechtliche Zugänglichkeit im Regelfall gegeben, wenn ein Grundstück von der Straße aus nur fußläufig betreten werden kann, etwa […] das Gebäude auf einem Baugrundstück in Hanglage von der Straße aus nur über Treppen zu erreichen ist […]. Dass das Bauordnungsrecht nicht ein Herauffahren auf das Grundstück und nicht einmal ein jederzeitiges Heranfahrenkönnen voraussetzt, zeigt auch die Regelung [der Landesbauordnung], wonach Stellplätze und Garagen auch auf anderen Grundstücken als dem Baugrundstück nachgewiesen werden können.“
Treppenzuwegung mit Wohnweg vergleichbar
Auf Grundlage dieser Maßstäbe kann angenommen werden, „dass der oben beschriebene Treppenzugang zum Grundstück der Klägerin mit einem Wohnweg […] vergleichbar ist und deshalb die Erreichbarkeit des Baugrundstücks für Fußgänger auch bauordnungsrechtlich den Erreichbarkeitsanforderungen genügt. Voraussetzung für die Annahme eines Wohnwegs ist zwar, dass der Weg straßenrechtlich dem Anliegerverkehr gewidmet ist.“ Vorliegend war das zwar nicht der Fall, aber die Treppe konnte nach der Rechtsprechung des OVGs entsprechend trotzdem entsprechend einem solchen behandelt werden.
Brandschutz stellt keine höheren Anforderungen
Die Landesbauordnung schreibt vorliegend vor, dass bei Wohnwegen auf die Befahrbarkeit verzichtet werden kann, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen.
„Ob Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen, richtet sich […] nach den Verhältnissen des Einzelfalls, insbesondere nach Größe, Art und Lage des Gebäudes und den Einsatzmöglichkeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst. So kann auf die Befahrbarkeit verzichtet werden, wenn bei ein- oder zweigeschossigen Gebäuden ein Heranfahren von Feuerwehrfahrzeugen unmittelbar an das Gebäude nicht erforderlich ist. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Länge des Wohnwegs. Im Hinblick auf eine wirkungsvolle Gewährleistung der Feuerlösch- und Rettungsarbeiten dürfte diese Länge bei ca. 80 m […] bzw. bei ca. 50 m liegen […].
Davon ausgehend bestehen […] im Hinblick auf die geringe Länge der Zuwegung und die Größe des Baugrundstücks […] keine Bedenken wegen des Brandschutzes. […]“
Konkrete Bebauung des Grundstücks ist irrelevant.
„Die Frage, ob im Hinblick auf den derzeitigen konkreten Baubestand auf dem Grundstück der Klägerin auf die Möglichkeit des Heranfahrens mit Kraftfahrzeugen in Bezug auf die hier zu beurteilende Erschließungsanlage verzichtet werden kann, ist im Übrigen nicht entscheidungserheblich. Für die Beurteilung der Frage, ob das Grundstück beitragsrechtlich relevant bebaubar ist, ist […] allein auf die abstrakte Bebaubarkeit des Grundstücks abzustellen. Dass auf dem „hypothetisch bislang nicht bebaubaren“ Grundstück der Klägerin eine erschließungsbeitragsrechtlich relevante Bebauung unter Einhaltung der Anforderungen des [Landesbauordnungsrechts] über den hier zu beurteilenden Zugang für Fußgänger - unter Umständen in einem geringeren Umfang - möglich wäre, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Vertiefung. […]“
„Soweit die Klägerin sinngemäß darauf abstellt, dass die Stellung der vorhandenen Gebäude zueinander und daraus folgend die gegebenen Zu- und Durchgänge auf dem Grundstück - in Bezug auf die streitgegenständliche Erschließungsanlage - brandschutzrechtlichen Anforderungen nicht entsprächen, ist dieser Vortrag rechtlich unerheblich. Denn der Erschließungsvorteil, den das Grundstück durch die Erschließungsanlage […] erfährt, besteht allein darin, dass es überhaupt erschließungsbeitragsrechtlich relevant bebaubar ist. Zudem kann ein Eigentümer sein Grundstück nicht durch ein selbst errichtetes Hindernis mit der Folge „verschließen“, dass es deshalb keiner Beitragspflicht unterliegt […]. Infolgedessen kann das Erschlossensein des Grundstücks der Klägerin von vornherein nicht daran scheitern, dass die Gebäude - so die Behauptung - auf diesem Grundstück in einer Art und Weise angeordnet sind, die eine Durchgangsmöglichkeit von der Erschließungsanlage aus verhindert. […]“
Breite der Zuwegung nicht ausreichend?
Die Klägerin trug darüber hinaus vor, der erforderliche Brandschutz werde deshalb nicht sichergestellt, weil die bislang vorhandene Öffnung im Zaun vor dem Treppenweg nur 90 cm breit und demnach zu schmal sei. Die Öffnung müsse mindestens 1,25 m breit sein. Aber auch diese Rüge blieb ohne Erfolg.
„Die Zugänglichkeit des Grundstücks erfordert zwar eine solche (angemessene) Breite an der Straße, dass die verkehrliche Erreichbarkeit durch Bewohner, Benutzer und Besucher sowie insbesondere die Zugänglichkeit im öffentlichen Interesse durch Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste usw. gewahrt wird. […]
Davon ausgehend steht jedoch die - nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin - bislang unzureichende Zugänglichkeit ihres Grundstücks der bauordnungsrechtlichen Erschließung nicht entgegen. Eine Anbaustraße sichert auch bei Bestehen eines rechtlichen oder/und tatsächlichen Erschließungshindernisses - und damit auch bei einem Zufahrts- oder Zugangshindernis tatsächlicher Art - die Erschließung im baurechtlichen Sinne der §§ 30 ff. BauGB und vermittelt danach auch die beitragsrechtlich relevante Bebaubarkeit, sofern die Beseitigung des Hindernisses verlässlich in Aussicht steht […]. Nichts Anderes kann für die verkehrliche Erreichbarkeit und damit für die Zugänglichkeit im bauordnungsrechtlichen Sinne gelten. Denn das Entstehen der sachlichen Beitragsschuld ist - wie dargelegt - vom sogenannten Baufall abgekoppelt, es genügt vielmehr die Baureife und damit die abstrakte Bebaubarkeit eines Grundstücks. Diese ist in der vorliegenden Konstellation zu bejahen, da die Beklagte im Zulassungsverfahren verbindlich ihre Bereitschaft erklärt hat, die Öffnung im Zaun auf eine lichte Breite von mindestens 1,25 m zu erweitern und damit eine entsprechende Zugänglichkeit […] sicherzustellen.“
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie die Erläuterungen zur Beitragspflicht in der Rdnr. 1001 ff.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite