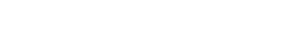Beitragspflichtigkeit eines Grundstücks – Hindernisse zwischen Straße und Grundstück
Der Fall:
Die Klägerin ist Eigentümerin eines mit drei Wohngebäuden bebauten Grundstücks. Die streitgegenständliche Straße wäre für das Grundstück eine Zweiterschließung. Zwischen Straße und Grundstück liegt ein ca. 2m breiter Grünstreifen, der im Eigentum der Gemeinde steht. Dieser Grünstreifen ist teilweise eingezäunt, teilweise durch eine Stützmauer eingefasst. Zudem verläuft auf dem dargestellten Geländestreifen von der Erschließungsanlage zum Grundstück der Klägerin ein befestigter Fußweg, der den vorhandenen Höhenunterschied von ca. 1,5 m mit einer Betontreppe überwindet; der Zaun ist an dieser Stelle unterrochen.
Als die Gemeinde einen Erschließungsbeitrag erhebt, geht die Klägerin gegen diesen gerichtlich vor. Der Grünstreifen mache den Beitragsbescheid rechtswidrig.
Die gerichtliche Entscheidung:
Das OVG sah das anders.
Verknüpfung von Baurecht und Beitragsrecht
Das Erschließungsbeitragsrecht macht die Beitragspflicht und damit das Entstehen der sachlichen Beitragsschuld für ein durch eine Erschließungsanlage erschlossenes Grundstück davon abhängig, dass das Grundstück baulich, gewerblich oder in einer vergleichbaren Weise genutzt werden darf. § 133 Abs. 1 BauGB „macht die Entstehung der sachlichen Beitragsschulden abhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen, unter denen das (bundesrechtliche) Bebauungsrecht und das (landesrechtliche) Bauordnungsrecht die zur Beitragspflicht führende bauliche, gewerbliche oder vergleichbare - beitragsrechtlich relevante - Grundstücksnutzung gestatten (st. Rspr.[…]). Bei der Prüfung, ob ein Grundstück tatsächlich und rechtlich, und zwar planungsrechtlich wie bauordnungsrechtlich, bebaubar […] ist, ist eine etwa vorhandene (Erst-)Erschließung durch eine andere Erschließungsanlage hinwegzudenken (st. Rspr. […]).
Für die Beurteilung der Frage, ob das Grundstück im genannten Sinne bebaubar ist, ist allein auf die abstrakte Bebaubarkeit des Grundstücks abzustellen, d.h. es ist danach zu fragen, ob eine bauliche Nutzung auf dem „hypothetisch bislang nicht bebaubaren“ Grundstück durch die zu beurteilende Erschließungsanlage abstrakt möglich wird. Denn der Erschließungsvorteil, den das Grundstück durch die Erschließungsanlage erfährt, besteht darin, dass es überhaupt erschließungsbeitragsrechtlich relevant bebaubar wird […]. Danach ist […] ein Grundprinzip des Erschließungsbeitragsrechts die Abkoppelung des Entstehens der sachlichen Beitragsschuld(-pflicht) vom sogenannten Baufall, d.h. der tatsächlichen Grundstücksnutzung, und das Anknüpfen an die Baureife, d.h. die zulässige Bebaubarkeit eines Grundstücks. Diese Grundsätze gelten insbesondere auch in den Fällen einer Zweiterschließung (Erschließung durch eine zweite oder weitere Anbaustraße), wenn - wie hier - die Bebaubarkeit für eine bereits vorhandene Bebauung - hier mit drei Wohnhäusern - durch eine weitere Erschließungsanlage sichergestellt wird.“
Bauplanungsrechtlich genügt ein Heranfahrenkönnen
„Das Bebauungsrecht macht in allen seinen Vorschriften die Zulässigkeit der Ausführung baulicher Anlagen von der Sicherung u.a. der verkehrlichen Erschließung abhängig (§§ 30 ff. BauGB). Diese verkehrliche Erschließung verlangt eine Erreichbarkeit dergestalt, dass an ein Grundstück herangefahren werden kann, sofern nicht das Bebauungsrecht ausnahmsweise - im Vergleich zu dieser Grundform der Erreichbarkeit - weniger, nämlich eine Erreichbarkeit lediglich für Fußgänger (Zugang), genügen lässt oder mehr, nämlich eine Erreichbarkeit in Form der Möglichkeit, mit Kraftfahrzeugen auf das Grundstück herauffahren zu dürfen, fordert (st. Rspr[…]).
In Wohngebieten werden Grundstücke durch eine Anbaustraße im Regelfall erschlossen im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB, wenn die Straße die Möglichkeit eröffnet, mit Personen- und Versorgungsfahrzeugen an sie heranzufahren und sie von da ab zu betreten. Ausreichend ist danach eine verkehrliche Erreichbarkeit, bei der mit Kraftfahrzeugen auf der Fahrbahn der öffentlichen Straße bis in Höhe des jeweiligen Anliegergrundstücks gefahren und dieses von da aus ohne Weiteres betreten werden kann (st. Rspr. […]). Diese Grundsätze gelten gleichermaßen im unbeplanten Innenbereich. Denn Sinn und Zweck der in allen die Zulässigkeit von Bauvorhaben betreffenden Vorschriften des Baugesetzbuches gleichlautend aufgestellten Zulässigkeitsvoraussetzungen der „gesicherten Erschließung“ gebieten eine Differenzierung nach Plangebieten und rein faktischen Innenbereichslagen nicht […]“
Grünstreifen, der überquert werden kann, stellt kein beachtliches Hindernis dar.
„Der verkehrlichen Erreichbarkeit für Fußgänger (Zugang) wird in der Regel auch dann genügt, wenn zwischen der Fahrbahn und dem Grundstück noch ein zur öffentlichen Straße gehörender - nur fußläufig zu überquerender - Streifen von ortsüblicher Breite liegt. Voraussetzung ist allerdings, dass der zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze liegende Zwischenraum in zumutbarer Weise überwunden werden kann […]. Dies wird für einen Gehweg und/oder Radweg in ortsüblicher Breite, aber auch für einen entsprechenden zur öffentlichen Straße gehörenden Grünstreifen regelmäßig zutreffen […].
Davon ausgehend ist es für das in einem Wohngebiet liegende Baugrundstück ausreichend, wenn eine Erreichbarkeit für Fußgänger (Zugang) besteht und die befestigte Zuwegung auf dem zwischen dem Grundstück der Klägerin und der Erschließungsanlage befindlichen Geländestreifen die verkehrliche Erreichbarkeit des Grundstücks bzw. den Zugang zum Grundstück der Klägerin auf Dauer gewährleistet. „Steht - wie hier - das trennende Anliegergrundstück im Eigentum der (beitragsberechtigten) Gemeinde, kann das ursprünglich bestehende rechtliche Erreichbarkeitshindernis von der Gemeinde dadurch beseitigt werden, dass sie das trennende Grundstück (nachträglich) durch Widmung zu einem Bestandteil der Anbaustraße macht und eine befestigte Zuwegung auf diesem Grundstücksstreifen anlegt, um auf diese Weise in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht sicherzustellen, dass das Hinterliegergrundstück von der Anbaustraße aus erreichbar ist […]). In dem Zeitpunkt, in dem der trennende Grundstücksstreifen (nachträglich) zum Straßenbestandteil gemacht wird, wächst das Hinterliegergrundstück gleichsam in die Beitragspflicht hinein […].
Da die Beklagte […] die streitgegenständliche Erschließungsanlage einschließlich des hier zu beurteilenden Geländestreifens für den öffentlichen Verkehr gewidmet hatte, bestand seitdem kein rechtliches Erreichbarkeitshindernis mehr.
Dass darüber hinaus die notwendige Erreichbarkeit des Grundstücks der Klägerin für Fußgänger (Zugang) von der Erschließungsanlage aus durch die ca. 1 m breite, betonierte Treppe, die zur Sturzsicherung mit einem Geländer versehen ist, und den sich daran anschließenden befestigten Weg gewährleistet wird, kann […] ohne Weiteres den sich in den Akten befindlichen Lichtbildern entnommen werden. Es ist insbesondere weder ersichtlich noch von der Klägerin dargelegt, dass und warum das fußläufige Überqueren des nicht zur Fahrbahn gehörenden Geländestreifens aus tatsächlichen Gründen unzumutbar sein könnte.“
Da auch keine bauordnungsrechtlichen Hindernisse der Bebaubarkeit entgegenstanden, hat das OVG den Erschließungsbeitragsbescheid als rechtmäßig angesehen.
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie die Erläuterungen zur Beitragspflicht in der Rdnr. 1001 ff.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite