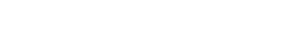Anlagenabgrenzung bei fehlender Anbaubestimmung einer Teilstrecke
Der Grundsatz:
Wie weit eine Straße als einzelne Erschließungsanlage reicht, bestimmt sich grundsätzlich nach dem Gesamteindruck, den die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse einem unbefangenen Beobachter vermitteln. Deshalb hat sich der ausschlaggebende Gesamteindruck ausgehend von einer natürlichen Betrachtungsweise an der Straßenführung, der Straßenlänge, der Straßenbreite und der Straßenausstattung auszurichten. Eine von dieser natürlichen Betrachtungsweise abweichende Beurteilung ist allerdings geboten, wenn Rechtsgründe zu einer anderen Abgrenzung zwingen. Der Gesichtspunkt der natürlichen Betrachtungsweise muss insbesondere dann zurücktreten, wenn nur eine Teilstecke der in der Natur einheitlichen Anlage zum Anbau bestimmt ist.
Der Fall:
Der höchstrichterlichen Entscheidung lag ein Rechtsstreit über die Heranziehung zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag zugrunde. Die abgerechnete Straße „Zum Steilufer“ besteht in der Natur – vereinfach dargestellt – aus einem 20 m langen Straßenstück (Teilstück 1), von dem ein 250 m langer Einbahnstraßenring mit Parkflächen (Teilstück 2) abzweigt. Das Grundstück des Klägers verfügt über eine Zufahrt zum Teilstück 1 und liegt zugleich (nordöstlich) am Teilstück 2 an.
Die höchstrichterliche Entscheidung:
Das Gericht hat entschieden, dass die maßgebliche Erschließungsanlage entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht beide Teilstücke zusammen, sondern aus Rechtsgründen nur das Teilstück 1 umfasst. Dies hat es wie folgt begründet:
Bei natürlicher Betrachtungsweise sind die beiden Teilstücke als einheitliche Erschließungsanlage zu beurteilen.
„Maßgebend für die Beurteilung der Frage, wo eine selbständige Erschließungsanlage beginnt und endet, ist ausgehend von einer natürlichen Betrachtungsweise das durch die tatsächlichen Gegebenheiten geprägte Erscheinungsbild. Es kommt danach weder auf die Parzellierung noch auf eine einheitliche oder unterschiedliche Straßenbezeichnung an. Maßgeblich sind vielmehr die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie z.B. durch die Straßenführung, Straßenbreite, Straßenlänge und Straßenausstattung geprägt werden und sich einem unbefangenen Beobachter bei natürlicher Betrachtungsweise darstellen. Unterschiede, die jeden der Straßenteile zu einem augenfällig abgegrenzten Element des öffentlichen Straßennetzes machen, kennzeichnen jeden dieser Straßenteile als eine eigene Erschließungsanlage. Erforderlich ist eine Würdigung aller dafür relevanten Umstände (…).
Dies zugrunde gelegt, hat das Oberverwaltungsgericht den Einbahnstraßenring (Teilstück 2) mitsamt dem die Zufahrt zum klägerischen Grundstück gewährleisteten Teilstück 1 der Straße ohne Verstoß gegen Bundesrecht als einheitliche Erschließungsanlage beurteilt. Nach seinen Feststellungen (…) wird ein Fahrzeug, das sich auf dem Teilstück 1 auf das Grundstück des Klägers zubewegt, entlang eines (…) Fußwegs in einer Kurve in den Einbahnstraßenring hineingeführt. Aus dem Einbahnstraßenring hinaus wird es in einer weiteren Kurve mit Bordsteinkanten auf das geradlinige Teilstück 1 zugeleitet. Diese Feststellungen tragen die Schlussfolgerung, dass sich das 20 m lange Teilstück 1 aus der Sicht eines unbefangenen Betrachters nach der vorhandenen Straßenführung als Teil des Einbahnstraßenrings darstellt.“
Der mit Parkflächen ausgestattete Einbahnstraßenring ist keine selbständige Parkfläche im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 BauGB.
„Offenbleiben kann insoweit, ob die Annahme selbständiger Parkflächen bereits deshalb ausgeschlossen ist, weil die gesamte Straße „Zum Steilufer" zwar als Ortsstraße gewidmet wurde, es aber an einer ausdrücklichen eigenen Widmung als Parkplatz fehlt (…).
Denn jedenfalls sind selbständige Parkflächen nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Regelfall keine beitragsfähigen Erschließungsanlagen, weil sie nur ausnahmsweise ihrer Erschließungsfunktion nach einem Abrechnungsgebiet zuzuordnen sind, das hinsichtlich des Kreises der erschlossenen Grundstücke hinreichend genau und überzeugend abgegrenzt werden kann (…). Einen solchen Ausnahmefall hat das Oberverwaltungsgericht nicht festgestellt, und er liegt auch offensichtlich nicht vor. Im Übrigen kann es sich bei Parkplätzen nur dann um selbständige Parkflächen im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 BauGB handeln, wenn damit ausschließlich Abstellplätze für Fahrzeuge geschaffen werden sollen. Ist die Verkehrsanlage hingegen auch zum Anbau bestimmt, so sind die Parkflächen Bestandteil einer Anbaustraße im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und stellen sich deshalb als unselbständige Parkflächen nach § 127 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 1 BauGB dar (…).“
Dennoch kann nicht die bei natürlicher Betrachtungsweise den Einbahnstraßenringmitumfassende einheitliche Straße, sondern nur das Teilstück 1 als beitragsfähig angesehenwerden. Denn der Einbahnstraßenring ist aus rechtlichen Gründen nicht Teil derbeitragsfähigen Anbaustraße.
Hierzu stellt das Gericht zunächst die Grundsätze dar:
„Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann eine nach natürlicher Betrachtungsweise einheitliche Erschließungsanlage im Einzelfall aus rechtlichen Gründen in erschließungsbeitragsrechtlich unterschiedlich zu beurteilende Einzelanlagen zerfallen, wenn sie nur auf einer Teilstrecke im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB zum Anbau bestimmt ist. Die Anbaubestimmung und die Eigenschaft als beitragsfähige Erschließungsanlage enden unter anderem dann, wenn der Straße nicht nur für eine unter dem Blickwinkel des Erschließungsbeitragsrechts nicht ins Gewicht fallende Teilstrecke die Bestimmung zum Anbau fehlt. Eine nicht anbaubare Teilstrecke fällt von ihrer Ausdehnung her erschließungsbeitragsrechtlich ins Gewicht mit der Folge, dass die Straße dort, wo sie in diese Teilstrecke übergeht, ihre Eigenschaft als beitragsfähige Anbaustraße verliert, wenn sie – erstens – selbst den Eindruck einer gewissen erschließungsrechtlichen Selbständigkeit vermittelt und – zweitens – im Verhältnis zu der Verkehrsanlage insgesamt nicht von lediglich untergeordneter Bedeutung ist (…).
Den Eindruck einer gewissen Selbständigkeit vermittelt eine beidseitig nicht anbaubare Teilstrecke dabei, wenn sie mehr als 100 m lang ist (…). Im Verhältnis zu der Verkehrsanlage insgesamt nicht von lediglich untergeordneter Bedeutung ist die betreffende Teilstrecke, wenn etwa ein Fünftel oder mehr einer Verkehrsanlage beidseitig nicht zum Anbau bestimmt ist (…).“
Ausgehend von diesen Grundsätzen zerfällt die nach natürlicher Betrachtungsweise einheitliche Straße in das Teilstück 1 als beitragsfähige Anbaustraße und den nichtbeitragsfähigen Einbahnstraßenring (Teilstück 2).
Dem Einbahnstraßenring fehlt die Anbaubestimmung, weil die angrenzenden Grundstückevon ihm aus nicht betreten werden können:
„Der Einbahnstraßenring ist nicht im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB zum Anbau bestimmt. Weder für das nordöstlich allein an ihn angrenzende Grundstück des Klägers noch für die an der gegenüberliegenden südwestlichen Straßenseite gelegenen Grundstücke des Ferienparks gibt er das her, was für die zulässige Bebauung dieser Grundstücke an Erschließung erforderlich ist (…). Hierfür muss die Straße in der Regel zumindest die Möglichkeit eröffnen, mit Personen– und Versorgungsfahrzeugen bis an die Grenze oder bis zur Höhe des Grundstücks heranzufahren und es von dort aus zu betreten (…). Daran fehlt es hier. Denn nach den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 11 der Gemeinde S. können die an den Einbahnstraßenring angrenzenden Grundstücke von dort nicht betreten werden. Auf der nordöstlichen Seite des Einbahnstraßenrings setzt der Bebauungsplan für den gesamten Straßenverlauf Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Sammelausgleich für das Plangebiet fest (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 1a BauGB). Die Flächen sind nach Nr. 6.3 der textlichen Festsetzungen dicht mit Gehölzen zu bepflanzen. Dabei ist je angefangenen 100 m² Fläche mindestens ein Baum und je m² mindestens ein Strauch zu pflanzen. Ein Betreten der angrenzenden Grundstücke vom Einbahnstraßenring aus ist damit ausgeschlossen. Auf der südwestlichen Seite sind Anpflanzgebote gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, zudem sind für diesen Bereich Ein– und Ausfahrten ausgeschlossen.
Nichts anderes folgt daraus, dass der nach Art. 14 Abs. 1 GG eigentumsrechtlich geschützte Anliegergebrauch einen Anpflanzungsgebote durchbrechenden Anspruch auf Zugang zu einer öffentlichen Verkehrsanlage begründen kann, wenn ein Grundstück für seine bebauungsrechtliche Nutzbarkeit auf die betreffende Straße angewiesen ist (…). Denn weder das nordöstlich gelegene Grundstück des Klägers noch die südwestlich angrenzenden Grundstücke des Ferienparks sind im Hinblick auf ihre nach den Bebauungsplänen Nr. 11 und Nr. 3 in der Fassung der 12. Änderung anderweitig gewährleistete Erschließung für ihre bebauungsrechtliche Nutzbarkeit auf einen Zugang zum Einbahnstraßenring angewiesen. (…)“
Der Einbahnstraßenring erfüllt auch die Voraussetzungen, unter denen eine nichtanbaubare Teilstrecke als beitragsrechtlich ins Gewicht fallend angesehen werden kann:
„Er ist mit einer Länge von 125 m je Richtung und einer Gesamtlänge von 250 m deutlich länger als die für seine erschließungsrechtliche Selbständigkeit erforderlichen 100 m. Damit ist außerdem deutlich mehr als ein Fünftel der nur um das 20 m lange Teilstück 1 längeren einheitlichen Verkehrsanlage beidseitig nicht zum Anbau bestimmt.“
Das Gericht bekräftigt: Die Anbaubestimmung entfällt auch dann, wenn die an die Straße angrenzenden Grundstücke zwar an sich bebaubar sind, die Straße aber nach den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht das hergibt, was für die zulässige bauliche Nutzung an Erschießung erforderlich ist.
„Dem Ergebnis, dass der Einbahnstraßenring als solcher nicht beitragsfähig ist, steht unter den hier vorliegenden Umständen auch nicht entgegen, dass die angrenzenden Grundstücke nach den Festsetzungen der für sie geltenden Bebauungspläne Nr. 3 und Nr. 11 an sich bebaubar sind.
Zwar endet die Anbaubestimmung einer einheitlichen Straße nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter anderem dann, wenn sie nicht nur für eine unter dem Blickwinkel des Erschließungsbeitragsrechts nicht ins Gewicht fallende Teilstrecke in den Außenbereich einmündet oder durch ein auf Grund entsprechender Festsetzungen beidseitig der Bebauung entzogenes Bebauungsplangebiet verläuft (…), die angrenzenden Grundstücke also schon kein Bauland darstellen. Dieser Rechtsprechung liegt der Gedanke zugrunde, dass eine öffentliche Straße im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB nur zum Anbau bestimmt ist, wenn und soweit sie die an sie angrenzenden Grundstücke nach Maßgabe der §§ 30 ff. BauGB bebaubar macht (…). An der Anbaubestimmung eines Straßenstücks fehlt es aber nicht nur, wenn die angrenzenden Grundstücke wegen ihrer Außenbereichslage nicht bebaubar sind oder durch die Festsetzungen eines Bebauungsplans einer Bebauung schlechthin entzogen sind, sondern auch dann, wenn die Straße nicht das hergibt, was für die an sich zulässige Bebauung der Grundstücke an Erschließung erforderlich ist, weil diese nach den Festsetzungen des Bebauungsplans von der Straße aus nicht betreten werden können (…). Denn in all diesen Fällen vermittelt die Straße den angrenzenden Grundstücken nicht die Bebaubarkeit. Sie verschafft ihnen deshalb nicht den über den Gemeinvorteil hinausgehenden spezifischen Erschließungsvorteil, der als Sondervorteil die Heranziehung der Grundstückseigentümer zu einem Erschließungsbeitrag rechtfertigt (…).“
Maßgeblich ist für das Gericht, dass die Bebaubarkeit des Grundstücks des Klägers nichtdurch das Teilstück 2, sondern allein durch das Teilstück 1 vermittelt wird.
„Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die Rechtsprechung zu beidseitig nicht zum Anbau bestimmten Teilstrecken im vorliegenden Fall auch nicht deshalb unanwendbar, weil an die nicht zum Anbau bestimmte, 125 m lange nordöstliche Hälfte des Einbahnstraßenrings nur das Grundstück des Klägers angrenzt, das über eine Zufahrt zum Teilstück 1 verfügt und deshalb auch entlang des Einbahnstraßenrings bebaubar und tatsächlich bebaut ist. Denn die der Rechtsprechung zugrunde liegende Erwägung, dass eine öffentliche Straße im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB nur zum Anbau bestimmt ist, wenn und soweit sie die an sie angrenzenden Grundstücke nach Maßgabe der §§ 30 ff. BauGB bebaubar macht (…), greift auch hier.
Zwar ist das Grundstück des Klägers trotz der fehlenden Anbaubestimmung des Einbahnstraßenrings bebaubar. Die Bebaubarkeit wird ihm aber nicht durch den Einbahnstraßenring vermittelt, der als letzter Teil der einheitlichen Erschließungsanlage hinter der Zufahrt zum Grundstück des Klägers angeordnet ist und im Wesentlichen nur dazu dient, die unselbständigen Parkflächen anzubinden. Unter diesen Umständen gibt der Einbahnstraßenring auf Grund der Festsetzungen des Bebauungsplans nicht das her, was für die bauliche Nutzung des Grundstücks an verkehrsmäßiger Erschließung erforderlich ist. Der Sondervorteil, der die Heranziehung des Klägers zum Erschließungsaufwand rechtfertigt, wird ihm also nicht durch den Einbahnstraßenring, sondern allein durch das Teilstück 1 der Straße „Zum Steilufer" verschafft.“
Eine Gegenausnahme kommt für an sich nicht zum Anbau bestimmte Teilstrecken mit unselbstständigen Parkflächen in Betracht, wenn diese erforderlich sind, um die durch die anbaubare Teilstrecke erschlossenen Grundstücke baulich nutzen zu können.
„Einer Anwendung der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den nicht zum Anbau bestimmten Teilstrecken einer nach natürlicher Betrachtungsweise einheitlichen Straße auf eine derartige Teilstrecke, die im Wesentlichen aus unselbständigen Parkflächen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 1 BauGB) besteht, kann allerdings entgegenstehen, dass diese erforderlich sind, um die durch die anbaubare Teilstrecke erschlossenen Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden Flächen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen (§ 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Unter dieser Voraussetzung zerfällt die nach den tatsächlichen Gegebenheiten einheitliche Verkehrsanlage nicht in erschließungsbeitragsrechtlich unterschiedlich zu behandelnde Teilflächen, sondern bleibt als einheitliche Anbaustraße insgesamt beitragsfähig.“
Das Gericht stellt zunächst wiederum die Grundsätze dar:
„Durch das Merkmal der Erforderlichkeit in § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll alles das vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand ferngehalten werden, was nicht einen beitragspflichtigen Sondervorteil, sondern einen beitragsfreien Gemeinvorteil verschafft. Bei Anbaustraßen ist dies mit Blick auf Aufwendungen für einen Verkehr anzunehmen, dessen Bewältigung nicht von der Erschließungsfunktion einer solchen Anlage erfasst wird (…).
Für die Beurteilung, ob eine Straße überhaupt und nach Art und Umfang im Sinne von § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderlich ist, ist der Gemeinde ein weiter Entscheidungsspielraum zuzubilligen. Durch das Merkmal der Erforderlichkeit wird lediglich eine äußerste Grenze markiert, die erst überschritten ist, wenn die von der Gemeinde im Einzelfall gewählte Lösung sachlich schlechthin unvertretbar ist, wenn es also nach Lage der Dinge mit Blick vor allem auf die durch diese Anlage erschlossenen Grundstücke und ihre bisherige Erschließungssituation keine sachlichen Gründe für eine Abwälzung der für die in Rede stehende Anbaustraße angefallenen Kosten in dem von der Gemeinde für richtig gehaltenen Umfang gibt. Die Gemeinde darf eine Lösung dann für erforderlich halten, wenn sie unter dem Blickwinkel der bestehenden Erschließungssituation der durch die Anlage erschlossenen Grundstücke als angemessen angesehen werden kann, d.h. für sie im Hinblick auf die Erschließungssituation der erschlossenen Grundstücke sachlich einleuchtende Gründe sprechen. Sind solche Gründe nicht ohne Weiteres ersichtlich, obliegt es der Gemeinde, sie aufzuzeigen. Gelingt ihr dies nicht, geht das zu ihren Lasten (…).“
Hiervon ausgehend stellt das Gericht hinsichtlich der Parkflächen entlang desEinbahnstraßenrings fest, dass diese nicht zur baulichen Nutzung des Grundstücks desKlägers erforderlich sind:
„Sie sind entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht deshalb der Erschließungssituation des klägerischen Grundstücks angemessen, weil nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Parkstreifen an städtischen Straßen als für die Erschließung erforderlich angesehen und bis zu einem Zehntel der auf den erschlossenen Grundstücken nutzbaren Geschossfläche für zulässig erachtet worden sind (....). Diese Rechtsprechung bezieht sich auf die Erschließungssituation in großstädtischen Bereichen. Sie ist auf Ferienparks, in denen die erforderlichen Stellplätze auf dem erschlossenen Grundstück selbst vorhanden sind, nicht übertragbar.“
„Auch im Übrigen sind keine einleuchtenden Gründe aufgezeigt, die vor dem Hintergrund der bisherigen Erschließungssituation des klägerischen Grundstücks für die Anlegung der Parkplätze entlang des Einbahnstraßenrings sprechen.
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 11 sind Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf auf dem Grundstück des Klägers selbst zulässig (Nr. 1.1 der textlichen Festsetzungen). Nach Nr. 3.4.2 seiner Begründung sind Stellplätze für den privaten ruhenden Verkehr auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen. Insoweit besteht für die Anlegung weiterer Stellplätze außerhalb des Sondergebiets kein sachlich einleuchtender Grund.
Dementsprechend steht die Schaffung solcher Parkplätze nach Nr. 1.1 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3, 12. Änderung, im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Strandpromenade, die eine Anpassung der Planungsinhalte hauptsächlich in Bezug auf Park– und Stellplatzflächen erforderlich macht. Die Parkplätze dienen dabei nach Nr. 4 der Begründung Strandbesuchern zum Abstellen ihrer Fahrzeuge. Daran knüpft der Bebauungsplan Nr. 11 nach Nr. 3.4.2 seiner Begründung an und passt die für die Parkplätze benötigte Fläche an die inzwischen vorliegende Ausbauplanung an. Als Stellplätze für Strandbesucher sind die Parkplätze entlang des Einbahnstraßenrings aber für die Erschließungssituation das Grundstück des Klägers ohne Bedeutung. Sie verschaffen ihm keinen Sondervorteil, sondern dienen allein der Allgemeinheit.
Ein im Hinblick auf die (bisherige) Erschließungssituation des Grundstücks einleuchtender Grund für die Anlegung der Parkplätze liegt auch nicht darin, dass sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auf dem Grundstück des Klägers ein weiterer Zugang zum Hansa–Park befindet, der über den auf dem Grundstück gelegenen Leuchtturm erfolgt und nicht nur für auf dem Grundstück wohnende Feriengäste, sondern für die Allgemeinheit geöffnet ist. Denn auch insoweit sind die Parkplätze entlang des Einbahnstraßenrings nicht erforderlich, um die Bauflächen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften nutzen zu können.
Der Zugang zum Hansa–Park ist bauplanungsrechtlich nicht gesichert. Zwar sieht der Bebauungsplan den Leuchtturm, von dem aus eine Brücke zum Hansa–Park führt, als Brücken– und Aussichtsturm vor und lässt in Nr. 2.4 der textlichen Festsetzungen dafür eine Überschreitung der sonst im Baugebiet zulässigen Gebäudehöhe zu. Der Bebauungsplan Nr. 3, 1. Änderung, der das Gelände des Hansa–Parks betrifft, enthält hingegen keine Festsetzungen zu einem entsprechenden Brückenbauwerk auf dem Hansa–Park–Gelände. Im Übrigen ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass der Zugang zum Hansa–Park bis zur Anlegung der Parkflächen am Einbahnstraßenring ausschließlich von den auf dem Grundstück des Klägers wohnenden Feriengästen genutzt wurde. Er löste damit im Einklang mit den planerischen Vorstellungen der Gemeinde, wie sie in den Bebauungsplänen Nr. 11 und Nr. 3, 12. Änderung, ihren Niederschlag gefunden haben, im Hinblick auf die Erschließungssituation des Grundstücks des Klägers keinen Parkplatzbedarf aus, der über die dort ohnehin vorhandenen Stellplätze hinausging.“
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens wird die Thematik der Anlagenabgrenzung nach natürlicher Betrachtungsweise einschließlich der aus Rechtsgründen gebotenen Ausnahmen in Rdnr. 7 sowie vor allem in Rdnr. 701 dargestellt. Zur Anlagenabgrenzung in den Fällen, in denen eine Anbaustraße (streckenweise) in den Außenbereich oder den sonstigen nicht anbaubaren Bereich übertritt, finden Sie Ausführungen in den Rdnrn. 20 ff. Die Thematik der unselbstständigen Parkflächen ist in Rdnr. 40, jene der selbstständigen Parkflächen in Rdnr. 41 f. kommentiert.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite