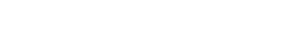Keine Ausweitung des Begriffs der Erschließungseinheit auf mehrere Hauptstraßen
Lehrbuchartig stellt das Bundesverwaltungsgericht hier seine über Jahre hinweg gefestigte Rechtsprechung zu den Grundsätzen der Erschließungseinheit dar.
Der Grundsatz:
Gemäß § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB (Bayern: i.V.m. Art. 5a Abs. 9 KAG) kann der Erschließungsaufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, insgesamt ermittelt werden.
Der Fall:
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hatte in seinem Urteil vom 16. Dezember 2014 – 5 A 624/13 – entschieden, eine Erschließungseinheit im Sinne des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB liege auch vor im Fall mehrerer vollkommen gleicher Straßen in einem abgegrenzten neu erschlossenen Gebiet mit nur zwei Zufahrten (E.-Straße und V.-Straße), in dem alle Anlieger zwingend auf die Benutzung einer dieser beiden Zufahrten (Hauptstraßen) angewiesen sind, um das sonstige Straßennetz der Gemeinde zu erreichen.
Die höchstrichterliche Entscheidung:
Das Bundesverwaltungsgericht hat dieser Auffassung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts eine eindeutige Absage erteilt und klargestellt, dass mehrere zusammenhängende Erschließungsanlagen nur dann eine Erschließungseinheit im Sinne des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB bilden, wenn alle Anliegergrundstücke ausschließlich über eine einzige dieser Erschließungsanlagen (Hauptstraße) mit dem übrigen Straßennetz verbunden sind.
Lehrbuchartig stellt das Bundesverwaltungsgericht zunächst seine über Jahre hinweg gefestigte Rechtsprechung zu den Grundsätzen der Erschließungseinheit dar:
„Mehrere Anlagen bilden nur dann im Sinne des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB ‚für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit‘, wenn sie in einem besonderen funktionalen Zusammenhang stehen. Eine derartige Erschließungseinheit kann nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus einer Hauptstraße und einer von ihr abzweigenden selbstständigen Nebenstraße - Stich- oder Ringstraße - bestehen (…). Den tragenden Grund für die Erschließungseinheit bildet insoweit das gemeinsame Angewiesen sein aller Anlieger auf die Benutzung der Hauptstraße. Es bewirkt, dass die durch die Hauptstraße erschlossenen Grundstücke keinen höheren Sondervorteil genießen als die durch die Nebenstraße erschlossenen Grundstücke. Diese durch die Hauptstraße vermittelte Vorteilsgemeinschaft rechtfertigt eine gemeinsame Ermittlung und Verteilung des Erschließungsaufwands mit dem Ziel, die Beitragsbelastung zugunsten der Anlieger der regelmäßig aufwändigeren Hauptstraße zu nivellieren (…). Dagegen darf die gemeinsame Abrechnung nicht zu einer Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße führen. Diese ist nicht vorteilsgerecht, weil die Nebenstraße ihrerseits den von der Hauptstraße erschlossenen Grundstücken keinen über den Gemeinvorteil hinausgehenden Sondervorteil bieten kann (…). Aus dem Gedanken der Vorteilsgemeinschaft, der dem § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB zugrunde liegt, folgt zugleich, dass sich das darin eingeräumte Ermessen unter bestimmten Umständen zu einer Rechtspflicht verdichten kann. Das der Gemeinde eingeräumte Ermessen, ob der Erschließungsaufwand unter den Voraussetzungen des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB insgesamt ermittelt werden soll, ist grundsätzlich auf Null reduziert, wenn die an der Hauptstraße liegenden Grundstücke im Vergleich zu den Grundstücken an der funktional abhängigen Nebenstraße bei Einzelabrechnung um mehr als ein Drittel höher belastet würden, der Beitragssatz der Hauptstraße mithin voraussichtlich vier Drittel des Beitragssatzes der Nebenstraße übersteigen würde.“
Anschließend bestätigt das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil vom 30. Januar 2013, in dem es unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung entschieden hatte, dass eine Erschließungseinheit auch bei mehreren, von einer gemeinsamen Hauptstraße abzweigenden selbstständigen Nebenstraßen vorliegen kann:
„Eine vergleichbare Vorteilsgemeinschaft besteht auch dann, wenn nicht nur eine, sondern mehrere Nebenstraßen von derselben Hauptstraße abzweigen (…) Auch hier bewirkt das gemeinsame Angewiesen sein aller Anlieger auf die Benutzung der einen Hauptstraße, dass der Sondervorteil der durch die Hauptstraße erschlossenen Grundstücke dem Sondervorteil der durch die Nebenstraßen erschlossenen Grundstücke entspricht. Entscheidend ist, dass alle gleichermaßen auf die Nutzung derselben Hauptstraße angewiesen sind. Der Umstand, dass die mehreren Nebenstraßen selbst den Anliegern der anderen Straßen keinen über den Gemeinvorteil hinausreichenden Sondervorteil bieten können, tritt dahinter zurück. Er ist auch hier nur insoweit von Bedeutung, als die gemeinsame Abrechnung keine Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße zur Folge haben darf (…). Die bereits erwähnte Pflicht zur gemeinsamen Abrechnung besteht in dieser Konstellation grundsätzlich dann, wenn der Beitragssatz für die Hauptstraße bei Einzelabrechnung um mehr als ein Drittel höher läge als die Beitragssätze für jede Nebenstraße (…).“
Einer noch weitergehenden Ausweitung des Begriffs der Erschließungseinheit auf den Fall mehrerer vollkommen gleicher Straßen in einem abgegrenzten neu erschlossenen Gebiet mit nur zwei Zufahrten (Hauptstraßen), in dem alle Anlieger zwingend auf die Benutzung einer dieser beiden Zufahrten angewiesen sind, erteilt das Bundesverwaltungsgericht hingegen eine klare Absage:
„Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts liegt kein entsprechend enger funktionaler Zusammenhang und damit auch keine vergleichbare Vorteilsgemeinschaft vor, wenn die Eigentümer aller Grundstücke eines Abrechnungsgebietes zwischen zwei (oder mehr) ‚Haupt‘-Verbindungsstraßen wählen können, um das sonstige Straßennetz der Gemeinde zu erreichen. In Ermangelung eines gemeinsamen Angewiesen seins aller auf die Benutzung derselben Hauptstraße fehlt es in solchen Konstellationen an einem rechtfertigenden Grund für eine Quersubventionierung sowohl zwischen denjenigen Straßen, die das Gebiet mit dem übrigen Straßennetz verbinden, als auch zwischen den von ihnen abhängigen Nebenstraßen.
Unabhängig davon scheitert die Annahme einer Erschließungseinheit unter den vorliegenden Umständen auch daran, dass sie gegen das Verbot einer Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße verstößt. Im Hinblick darauf, dass die unterschiedlichen Beitragssätze bei einer getrennten Abrechnung der Straßen hier allein auf der unterschiedlichen Größe der jeweils anliegenden Nutzungsflächen beruhen, liegen sie für die beiden Hauptstraßen (E.-Straße und V.-Straße) unter dem Einheitssatz. Deren Anlieger stehen sich deshalb bei einer Einzelabrechnung günstiger als bei einer gemeinsamen Abrechnung, die auch von daher nicht in Betracht kommt. Das Argument des Oberverwaltungsgerichts, gerade wegen der erheblichen Spreizung der Beitragssätze für die einzelnen, jeweils gleich ausgestalteten Erschließungsanlagen bestehe auch unter den vorliegenden Umständen nicht nur eine Befugnis, sondern sogar die Rechtspflicht zur Gesamtermittlung des Erschließungsaufwands, verkennt die Normstruktur des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB; denn dieser setzt für die Entscheidung über eine Gesamtabrechnung bereits tatbestandlich das Bestehen einer Erschließungseinheit voraus, überlässt ihre Bildung mithin - anders als etwa § 37 Abs. 3 KAG BW (…) - nicht einer Ermessensentscheidung der Gemeinde.“
Unsere Hinweise:
Die Daten der vorgestellten Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie Erläuterungen zu diesen Themen in Rn. 750 ff.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.
Bitte Ihr Passwort eingeben:


 Startseite
Startseite