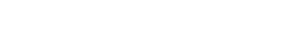Anforderung an Zugang; tatsächliches und rechtliches Zugangshindernis über gewidmeten Grünstreifen als Straßenbegleitgrün
Wenn an der Grenze zwischen Straße und Grundstück ein beachtliches sowohl tatsächliches als auch rechtliches Zugangshindernis auf Straßengrund besteht...
Der Fall:
Der Kläger wendet sich gegen seine Heranziehung zu einem Straßenausbaubeitrag für die Erneuerung und Verbesserung der Kellerstraße. Er ist Miteigentümer des Grundstücks‚ das zwischen der Kellerstraße (im Norden), der Straße Der Alte Berg (im Westen) und der Veit-Stoß-Straße (im Süden) liegt. Die Kellerstraße steigt ab der Abzweigung von der Straße Der Alte Berg in Richtung Osten stetig an. Ihre Fahrbahn ist von dem zunehmend tiefer liegenden Grundstück des Klägers durch einen zur Straße gehörenden, immer steiler abfallenden Grünstreifen getrennt.
Das Verwaltungsgericht hat diesen Beitragsbescheid aufgehoben und zur Begründung ausgeführt: Das Grundstück grenze zwar auf einer Länge von ca. 100 m unmittelbar an die Straßengrundstücke an. Es sei aber von der Fahrbahn durch den nach Osten immer breiter werdenden und steiler zum Grundstück abfallenden Grünstreifen getrennt. Dieser Grünstreifen könne zwar nicht durchgehend als tatsächliches Hindernis für einen Zugang von der Straße auf das Grundstück angesehen werden‚ weil er zumindest auf den ersten ca. 20 m von Westen aus gesehen weder zu breit noch zu steil sei, um ein Betreten als unzumutbar anzusehen. Es bestehe aber ein rechtliches Zugangshindernis‚ denn im Hinblick auf die vom Gemeinderat beschlossene und später auch beschlussgemäß verwirklichte Bepflanzung des Grünstreifens könne nur der Schluss gezogen werden‚ dass dieser Streifen nicht in der Weise dem Gemeingebrauch gewidmet sei‚ dass dem Kläger eine Zugangsmöglichkeit zu seinem Grundstück verschafft werden sollte.
Das Berufungsgericht hat zwar die Berufung zugelassen, die Aufhebung des Beitragsbescheids jedoch bestätigt.
Die obergerichtliche Entscheidung:
Zwar ist die Ausbaumaßnahme nach Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 3 KAG in Verbindung mit der Ausbaubeitragssatzung der Beklagten beitragsfähig. Das Grundstück des Klägers unterliegt aber nicht der Beitragspflicht, wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat. Es fehlt an dem erforderlichen Sondervorteil im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG, weil sich über die gesamte Länge der gemeinsamen Grenze zwischen Straße und Grundstück ein beachtliches sowohl tatsächliches als auch rechtliches Zugangshindernis auf Straßengrund befindet.
1. Eine vorteilsrelevante Inanspruchnahmemöglichkeit einer ausgebauten Straße setzt eine Erreichbarkeit voraus, die für die bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstücks erforderlich ist.
Für einen Sondervorteil im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG sind nach der Rechtsprechung des Senats zwei Merkmale entscheidend: zum einen die spezifische Nähe des Grundstücks zur ausgebauten Ortsstraße, wie sie bei Anliegergrundstücken und ihnen aus dem Blickwinkel einer rechtlich gesicherten Inanspruchnahmemöglichkeit grundsätzlich gleich zu stellenden Hinterliegergrundstücken gegeben ist, zum anderen eine Grundstücksnutzung, auf die sich die durch den Ausbau verbesserte Möglichkeit, als Anlieger von der Ortsstraße Gebrauch zu machen, positiv auswirken kann. Den Eigentümern von Flächen‚ bei denen beide Voraussetzungen vorliegen‚ kommt der Straßenausbau in einer Weise zugute‚ die sie aus dem Kreis der sonstigen Straßenbenutzer heraushebt und die Heranziehung zu einem Beitrag rechtfertigt (ständige Rechtsprechung, vgl. BayVGH‚ U.v. 8.3.2010 – 6 B 09.1957 – juris Rn. 18; B.v. 12.12.2016 – 6 ZB 16.1404 – juris Rn. 8 m.w.N.). Bei der Erhebung eines Straßenausbaubeitrags genügt zur Annahme eines Sondervorteils – anders als im Erschließungsbeitragsrecht – bereits die qualifizierte Inanspruchnahmemöglichkeit einer vorhandenen‚ lediglich erneuerten oder verbesserten Ortsstraße als solche. Diese kommt im Grundsatz jeder sinnvollen und zulässigen‚ nicht nur der baulichen oder gewerblichen Nutzung zugute, soweit sie rechtlich gesichert ausgeübt werden kann (BayVGH, U.v. 8.3.2010 – 6 B 09.1957 – juris Rn. 18). Zugrundezulegen sind dabei die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten. Im Straßenausbaubeitragsrecht, das die das Erschließungsbeitragsrecht kennzeichnende Unterscheidung zwischen erschlossenen (§ 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB) und bebaubaren (§ 133 Abs. 1 Satz 1 BauGB) Grundstücken nicht kennt, sind nämlich an der Aufwandsverteilung und damit zugleich an der Beitragserhebung nur diejenigen Grundstücke zu beteiligen, denen die Ausbaumaßnahme im maßgeblichen Zeitpunkt einen aktuellen Sondervorteil im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG vermittelt (BayVGH, B.v. 8.3.2013 – 6 B 12.2220 – juris Rn. 12 m.w.N.).
Eine vorteilsrelevante Inanspruchnahmemöglichkeit der ausgebauten Straße von einem bestimmten Grundstück aus setzt eine Erreichbarkeit voraus, die für dessen bestimmungsgemäße Nutzung erforderlich ist. Dazu bedarf es in der Regel und so auch für das Grundstück des Klägers der Erreichbarkeit mit Kraftfahrzeugen (Heranfahrenkönnen). Diese Grundform der Erreichbarkeit ist erfüllt, wenn auf der Fahrbahn der ausgebauten Ortsstraße bis zur Höhe dieses Grundstücks mit Personen- und kleineren Versorgungsfahrzeugen gefahren und es von da ab gegebenenfalls über einen dazwischen liegenden Gehweg, Radweg oder Seitenstreifen in rechtlich zulässiger und tatsächlich zumutbarer Weise betreten werden kann (vgl. BayVGH‚ B.v. 8.3.2013 – 6 B 12.2220 – juris Rn. 13; B.v. 28.9.2015 – 6 B 14.606 – juris Rn. 21 m.w.N.).
2. Ein Zugang muss eine Breite von mindestens 1,25 m haben.
Diese Erreichbarkeitsanforderungen sind nicht erfüllt. Die begrünte Böschung, die sich auf den Straßengrundstücken zwischen Fahrbahn und der Grenze zum klägerischen Grundstück befindet, bildet auf der gesamten Länge ein tatsächliches sowie rechtliches Zugangshindernis, das eine Beitragspflicht ausschließt.
Dass der Grünstreifen schon aus tatsächlichen Gründen ein Betretenkönnen hindert, steht für den östlichen Grundstücksbereich außer Frage. Denn die Kellerstraße steigt ab der Abzweigung von der Straße Der Alte Berg in Richtung Osten stetig an, sodass das zunächst höhengleiche klägerische Grundstück zunehmend tiefer liegt und die Böschung dementsprechend immer breiter und steiler wird. Dort ist die bis zu acht Meter breite und um mehrere Meter abfallende Böschung nicht begehbar. In Betracht kommt eine Zugangsmöglichkeit nur im westlichen Bereich unmittelbar an der Abzweigung von der Straße Der Alte Berg.
Am Beginn der Kellerstraße, also auf der Höhe des östlichen der drei Grenzsteine, ist der zur Straße gehörende Grünstreifen zwischen Fahrbahn und dem klägerischen Grundstück ca. 70 cm breit‚ mit Gras bewachsen und eben. Bezogen auf diesen Punkt dürfte der Grünstreifen in tatsächlicher Hinsicht noch kein beachtliches Hindernis darstellen, weil er die ortübliche Breite wohl nicht überschreitet und in zumutbarer Weise betreten werden kann (vgl. etwa BayVGH, B.v. 6.11.2012 – 6 ZB 12.187 – juris Rn. 10). Für die erforderliche Zugänglichkeit genügt eine bloß punktförmige Betrachtung aber nicht. Denn um das Heranfahren- und Betretenkönnen sicherzustellen, muss eine angemessene Breite zur Verfügung stehen (vgl. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 BayBO), die nicht zuletzt im Interesse des Brandschutzes (vgl. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayBO) mindestens 1,25 m betragen muss (vgl. OVG Lüneburg‚ B.v. 9.11.2012 – 9 LA 157/11 – juris Rn. 8 m.w.N.). Bezogen auf diese Mindestbreite bildet der Grünstreifen jedoch bereits ein beachtliches tatsächliches Zugangshindernis. Denn unmittelbar nach dem Beginn der Kellerstraße wird der Grünstreifen nicht nur zunehmend breiter, sondern auch deutlich abschüssig und ist zudem mit einer immer breiter werdenden Hecke auch auf dem Straßengrundstück bepflanzt. Schon auf der Mindestbreite kann er deshalb, zumal bei Nässe und Schnee, nicht mehr in zumutbarer Weise und verkehrssicher überquert werden, um auf das klägerische Grundstück zu gelangen.
3. Die Widmung muss das Recht einschließen einen Zugang über den Grünstreifen zu nehmen.
Unabhängig davon bildet der Grünstreifen‚ wie das Verwaltungsgericht zutreffend entschieden hat‚ auch ein rechtliches Zugangshindernis.
Der Gemeinderat der Beklagten hat – vor dem Entstehen der sachlichen Beitragspflichten – am 15. Dezember 2009 und 13. Juli 2010 einen Bepflanzungsplan für den Böschungsbereich der Kellerstraße beschlossen. Danach soll der Bereich in seiner gesamten Ausdehnung entlang des klägerischen Grundstücks weder allgemein zum fußläufigen Begehen noch als Zugang für das klägerische Grundstück zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn die Kellerstraße selbst einschließlich des Grünstreifens als Straßenbestandteil straßenrechtlich dem öffentlichen Verkehr gewidmet ist‚ schließt das für den Kläger noch nicht zwangsläufig das Recht ein‚ die Kellerstraße im Rahmen des Gemeingebrauchs von seinem Grundstück aus über den Grünstreifen bzw. bestimmte Teilflächen zu erreichen. Da der Gemeingebrauch nur im Rahmen der Widmung erlaubt ist (Art. 14 BayStrWG)‚ wird der Umfang des Gemeingebrauchs durch die Widmung begrenzt. Dabei bezieht sich die Begrenzung des Gemeingebrauchs auf den „Rahmen der Widmung“ nicht nur auf den Rechtsakt und die sich daraus ergebenden Beschränkungen hinsichtlich der Verkehrsarten und des Verkehrszwecks‚ sondern auch auf den Realakt der Schaffung und Indienststellung des dinglichen Substrats und damit auf dessen bau- und verkehrstechnische Beschaffenheit. Die verkehrsmäßige Nutzung ist insbesondere auf die Verkehrsfläche der Straße beschränkt und erstreckt sich nicht auf Bestandteile der Straße‚ auf denen nach ihrer baulichen Beschaffenheit und technischen Zweckbestimmung kein Verkehr stattfindet (vgl. ThürOVG‚ B.v. 10.2.2003 – 4 ZEO 1139/98 – juris Rn. 9 m.w.N.).
Der Grünstreifen entlang der Kellerstraße ist zwar Straßenbestandteil‚ aber mit Blick auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 15. Dezember 2009 und 13. Juli 2010 weder dazu bestimmt noch wegen der vorgegebenen Bepflanzung mit Sträuchern und Bäumen dazu geeignet‚ als wegemäßiger Zugang zum Anliegergrundstück genutzt zu werden. Ein „Sich-durchfädeln-müssen“ durch den Bewuchs entspricht nicht den Anforderungen an einen Zugang (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, B.v. 16.12.2016 – 9 B 1.15 – juris Rn. 16) und würde wegen der Gefährdung des Bewuchses auch den Gemeinderatsbeschlüssen widersprechen‚ mit denen „aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes sowie des Ortsbildes und nicht zuletzt des Vertrauensschutzes in den – bisherigen – Bestand“ der ursprüngliche‚ vor Beginn der Ausbaumaßnahme existierende Zustand wiederhergestellt werden sollte. Wie die vorgelegten Fotos zeigen, befand sich vor Beginn der Ausbaumaßnahmen auf dem Grünstreifen eine üppige, undurchdringliche Bepflanzung, die den klägerischen Betrieb vor der gegenüberliegenden Wohnbebauung völlig verbarg. Eben diese Abschirmung wollte die Beklagte zum Schutze der Wohnbebauung vor dem Gewerbebetrieb erneut schaffen. Dieser im beschlossenen Pflanzplan manifestierte Wille der Beklagten verhindert gleichzeitig die Erreichbarkeit des klägerischen Grundstücks von der Kellerstraße aus, da auch eine nur schmale Zuwegung die Durchbrechung des als Abschirmung gedachten Pflanzstreifens bewirken würde. Dem Kläger kann auch kein gesteigertes Recht als Straßenanlieger zustehen, weil sein Grundstück bereits eine anderweitige Zufahrt über die Straße Der Alte Berg hat und zur Nutzung nicht auf einen weiteren Zugang zur Kellerstraße angewiesen ist.
Das Zugangshindernis schließt eine Beitragspflicht für das klägerische Grundstück aus.
4. Die Gemeinde kann Hindernisse vor Entstehung der Beitragspflicht beseitigen.
Zwar kann ein Hindernis auf Straßengrund von der Gemeinde ohne weiteres – hier durch Erweiterung der Widmung und Anlegung eines Zugangs bis zur Grenze des klägerischen Grundstücks – beseitigt werden, wobei zur Beseitigung im Regelfall bereits die rechtlich verbindliche Zusicherung gegenüber dem Eigentümer des Anliegergrundstücks ausreicht, das rechtliche und/oder tatsächliche Hindernis auf dessen Anforderung zu beseitigen. Das muss jedoch, um eine Beitragspflicht für dieses Grundstück entstehen zu lassen, spätestens bis zum Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten für die abzurechnende Ausbaumaßnahme geschehen sein (BayVGH München, B.v. 8.3.2013 – 6 B 12.2220 – juris Rn. 14) Das ist hier jedoch nicht erfolgt.
Weiterleitende Hinweise:
Die Daten der obergerichtlichen Entscheidung finden Sie in unseren Tipps für die Praxis. In Ihrem Matloch/Wiens finden Sie Erläuterungen zu den Erreichbarkeitserfordernissen unter Rdnrn. 2160 und unter 829 zum Erschließungsbeitragsrecht.
Unsere Tipps für die Praxis:
Exklusiv für die Bezieher des Matloch/Wiens Erschliessungsbeitragsrechts. Die Tipps für die Praxis tragen dazu bei, die schwierige Materie in den Alltag zu integrieren.
Das Passwort erhalten Sie mit der aktuellen Ergänzungslieferung. Sie finden es auf der Rückseite des Vorworts. Wenn sie Cookies auf Ihrem PC aktivieren, genügt die einmalige Eingabe des Passwortes.
Sie sind nicht Bezieher des Matloch/Wiens und möchten die Tipps für die Praxis lesen? Dann klicken Sie bitte auf Service.


 Startseite
Startseite